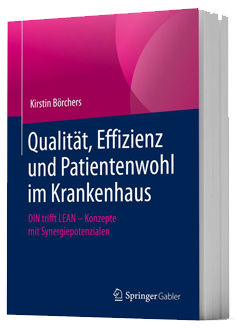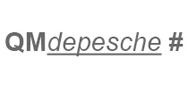Wie gelingt es, interne Audits an den Strukturwandel in Krankenhäusern anzupassen?
Mit genau dieser Frage hat sich Laura Bartsch in ihrer Masterarbeit beschäftigt – und dafür gleich eine besondere Anerkennung erhalten: Der Springer Verlag hat ihre Arbeit mit der BestMasters-Auszeichnung prämiert. Betreut wurde die Thesis von Prof. Kirstin Börchers. Wir wollten mehr wissen – über die Hintergründe der Arbeit, die Bedeutung der Auszeichnung und die Zusammenarbeit zwischen Studierender und Professorin.
Interview:
Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, Frau Bartsch – eine ganz besondere Anerkennung, die Sie mit dieser Auszeichnung erhalten haben.
Vielen Dank! Ich habe mich wirklich sehr gefreut – damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich kannte das BestMasters-Programm von Springer vorher gar nicht. Deshalb war ich zunächst ziemlich überrascht, als Professor Börchers mich fragte, ob sie meine Masterarbeit einreichen dürfe. Ich dachte: „Ja klar, ich habe ja nichts zu verlieren.“ Und dann kam tatsächlich schon nach wenigen Tagen die Rückmeldung. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut!
Wie kam es dazu, dass Sie sich mit dem Thema Strukturwandel im Krankenhaus und den Perspektiven interner Audits beschäftigt haben? Gab es einen konkreten Auslöser oder persönlichen Bezug?
Das Thema, so wie es jetzt ist, wurde von Professor Börchers vorgeschlagen. Ich hatte mich bei ihr beworben und wusste, dass ich im Bereich Qualitätsmanagement schreiben wollte – ursprünglich hatte ich eher in Richtung Risikomanagement gedacht. Als ich sie danach fragte, erzählte sie mir, dass sie selbst aktuell im Bereich interne Audits und Agilität forscht. Sie bot mir dann ein Thema in diesem Kontext an, das parallel zu ihrer Forschung läuft. Anfangs konnte ich mit „Agilität“ und „Agilen Audits“ noch nicht so viel anfangen und hatte erst Zweifel, ob das wirklich mein Thema ist – aber am Ende war ich super zufrieden. Ich konnte gut was daraus machen, ich habe viel gefunden und so ist das Thema dann entstanden.
Welche Rückmeldungen haben Sie seit der Veröffentlichung Ihrer Arbeit erhalten – aus der Wissenschaft oder aus der Praxis?
Bisher habe ich tatsächlich nur private Rückmeldungen bekommen, zum Beispiel von meiner Familie, die sich gleich das Buch kaufen oder das eBook lesen wollte. Viele verstehen das Thema auf Anhieb nicht so gut, wenn sie es nur überfliegen. Aber gerade aus meinem persönlichen Umfeld habe ich viele positive Rückmeldungen erhalten. Die Veröffentlichung hat sich bislang allerdings noch nicht besonders verbreitet – auch nicht bei den Interviewpartner:innen oder Teilnehmer:innen der quantitativen Befragung. Ich habe mit Professor Börchers bereits darüber gesprochen, dass ich ihnen mal den Link zur Veröffentlichung schicke – wer möchte, kann sich das Buch dann gerne anschauen. Das steht also noch aus, wäre aber eine gute Gelegenheit, noch ein bisschen Werbung zu machen.
Was war für Sie persönlich die größte Herausforderung bei der Erstellung Ihrer Masterarbeit – eher der theoretische Teil, die empirische Forschung oder die methodische Umsetzung?
Der Einstieg war definitiv herausfordernd – ein grobes Gefühl dafür zu bekommen, wie die Masterarbeit ablaufen soll, wie der rote Faden aussehen kann. Aber ich habe relativ schnell gute Literatur gefunden, an der ich mich orientieren konnte. Eine größere Herausforderung war dann die praktische Umsetzung – insbesondere die Suche nach geeigneten Interviewpartner:innen. Ich hatte bestimmte Kriterien aufgestellt, die die Expert:innen erfüllen mussten. Diese zu finden, war nicht ganz einfach, da das Thema Agile Audits noch relativ neu ist. Aber am Ende hat es gut geklappt, die Interviews verliefen super. Einerseits war es gut, dass das Thema so speziell war – das Ziel war ja, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Andererseits war es dadurch auch aufwendiger, an Informationen zu kommen.
In Ihrer Arbeit sprechen Sie von einem grundlegenden Strukturwandel in der Krankenhauslandschaft. Wie würden Sie diesen Wandel in wenigen Worten beschreiben?
Im Kern geht es um mehr Qualität, mehr Qualitätssicherung und damit verbunden auch um eine stärkere Fokussierung auf die Patientensicherheit. Dazu kommt die flächendeckende medizinische Versorgung, die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die generelle Abstimmung im Gesundheitssystem. Ein großes Thema ist auch die Digitalisierung – das kam in der Arbeit häufig vor. Gerade bei Dokumentationsprozessen besteht noch viel Bedarf nach digitalen Lösungen, die Kommunikation erleichtern und beschleunigen könnten.
Sie verfolgen einen Mixed-Methods-Ansatz. Was war der Grund für die Kombination qualitativer und quantitativer Methoden?
Ursprünglich wollte ich nur quantitativ forschen, stellte aber mit Professor Börchers schnell fest, dass das allein nicht ausreicht, um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Die quantitative Forschung diente bei mir als Grundlage, etwa zur Ermittlung der aktuellen Lage im Qualitätsmanagement. Darauf aufbauend habe ich dann qualitative Interviews geführt, um ein mehrperspektivisches Bild zu erhalten. In den Fragebögen gab es kaum offene Fragen – da ist die Aussagekraft begrenzt. Die subjektiven Erfahrungen der Expert:innen waren deshalb sehr wichtig. In den Interviews kamen dann viele Aspekte zur Sprache, die man in einer Online-Befragung so gar nicht hätte abfragen können.
Warum sehen Sie interne Audits als ein zentrales Instrument zur Qualitätssicherung im Krankenhauswesen?
Interne Audits dienen dazu, Abläufe und Prozesse innerhalb eines Krankenhauses systematisch zu prüfen – meist mithilfe von Checklisten, die auf Qualitätskriterien ausgerichtet sind. Durch den Vergleich von Ist- und Soll-Zustand erkennt man, wo es Verbesserungsbedarf gibt und was gut funktioniert. Da Audits regelmäßig durchgeführt werden, ermöglichen sie auch Vergleiche zu früheren Ergebnissen – was hat sich verbessert oder verschlechtert, was wurde umgesetzt?
Welche Rolle spielen interne Audits bei der Sicherung der Behandlungsqualität?
Insbesondere im Hinblick auf Risiken – das war auch ein zentrales Thema in der Masterarbeit. Viele sagten, es passieren noch zu viele Risiken, etwa bei der Medikamentengabe oder in OPs. Durch interne Audits kann man gezielt an diesen Risiken ansetzen und versuchen, sie zu minimieren – auch wenn man sie nie ganz ausschließen kann. Aber bereits eine Minimierung wäre ein wichtiger Schritt in Richtung besserer Behandlungsqualität.
Welche Herausforderungen treten bei klassischen Konformitätsaudits auf?
Vor allem der Zeitaufwand – sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Durchführung. Viele Dokumente müssen gesichtet werden, und wenn keine Auditsoftware vorhanden ist, läuft vieles händisch ab. Auch fehlt es oft an qualifiziertem Personal. Das alles macht klassische Audits sehr aufwendig. Anders beim agilen Audit: Hier gibt es mehr Zwischenschritte, kontinuierliche Kommunikation und frühzeitige Handlungsempfehlungen. Risiken können sofort angesprochen und behoben werden – nicht erst am Ende.
Wie bewerten Sie Effizienz und Effektivität der klassischen Auditverfahren?
Die klassischen Audits sind sehr wichtig und nicht grundsätzlich schlecht. Sie legen großen Wert auf eine ausführliche Dokumentation und gründliche Vorbereitung. Dennoch könnte man überlegen, bestimmte Elemente beider Auditarten zu kombinieren – je nach Einrichtung. So ließe sich die Wirksamkeit verbessern, ohne bewährte Verfahren ganz abzuschaffen.
Welche Vorteile versprechen Sie sich von einem iterativen, agilen Auditprozess?
Wie schon erwähnt: Risiken können frühzeitig erkannt und direkt adressiert werden – das ist ein klarer Vorteil. Zudem werden die Mitarbeitenden stärker einbezogen, jeder kennt seine Rolle und Verantwortung. Auch die Arbeitsatmosphäre ist angenehmer – das wurde mir in den Interviews oft zurückgemeldet. Agile Audits wirken weniger wie eine klassische Prüfsituation, was die Zusammenarbeit fördert.
Sehen Sie organisatorische oder personelle Hürden bei der Einführung agiler Audits?
Ich sehe die Hürde eher in der Umstellung der Prozesse, weniger personell. Viele Einrichtungen sind an bestehende Systeme gewöhnt und scheuen Veränderungen. Es braucht also die Bereitschaft zur Veränderung – das ist ein Lernprozess. Aber wenn dieser einmal durchlaufen ist, bieten agile Verfahren großes Potenzial.
Welche Rolle spielt Digitalisierung im aktuellen Qualitätsmanagement?
Digitalisierung sollte eine deutlich wichtigere Rolle spielen, als sie es aktuell tut. Viele Prozesse sind noch veraltet und kosten unnötig viel Zeit – das könnte man mit digitalen Tools vereinfachen und gleichzeitig das Personal entlasten. Besonders im Bereich Auditsoftware gibt es großen Bedarf – Checklisten, Fotos, Berichte könnten zentral gespeichert und ausgewertet werden. So etwas fehlt vielerorts noch.
Wäre ein digitales Tool zur Verbesserung interner Auditprozesse ein Wunsch von Ihnen?
Absolut! In den Interviews wurde deutlich, dass so ein Tool vieles erleichtern würde. Natürlich ist Digitalisierung auch immer eine Umstellung, aber wenn man sich einmal eingearbeitet hat, ist der Gewinn enorm.
Welche Entwicklungen erwarten Sie in den nächsten fünf Jahren im Bereich internes Audit und Qualitätsmanagement im Krankenhauswesen?
Ich hoffe und denke, dass es stärker in Richtung Agilität gehen wird. Andere Branchen machen es vor – warum sollte das Gesundheitswesen nicht davon profitieren? Eine Kombination aus klassischen und agilen Verfahren erscheint mir realistisch. Außerdem hoffe ich auf eine bessere Digitalisierung und bessere digitale Tools im Qualitätsmanagement.
Abschließend: Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit Professor Börchers während Ihrer Masterarbeit erlebt?
Die Zusammenarbeit war wirklich sehr angenehm. Man merkte, dass Professor Börchers viel Erfahrung hat und weiß, wie sie Studierende begleiten muss. Ich habe mich gut betreut gefühlt – wir hatten regelmäßige Meetings, sie war jederzeit erreichbar und hat mir wertvolle Literaturtipps gegeben. Besonders hilfreich war der Impuls, einen Projektplan zu erstellen – so hatte ich jederzeit einen Überblick über meinen Fortschritt. Auch im Nachhinein war der Kontakt sehr herzlich, sei es im Zusammenhang mit dem BestMasters-Programm oder einfach zur Nachfrage, wie es mir geht. Dafür bin ich sehr dankbar – es war eine großartige Betreuung!
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit!
Das Gespräch mit Laura Bartsch zeigt: Wissenschaftliche Exzellenz entsteht nicht nur durch ein relevantes Thema, sondern auch durch Neugier, Engagement – und eine starke Betreuung. Ihre Auszeichnung ist damit nicht nur eine persönliche Ehrung, sondern auch ein Impuls, den Wandel im Gesundheitswesen aktiv mitzugestalten.